|
|
|
|||||||||||||||||||||||
The Human Genome Project und seine Folgen für Menschenbild und EthikChristoph Rehmann-Sutter, Universität BaselDas Human Genome Project (HGP) eröffnet eine Vielzahl neuer biomedizinischer
Möglichkeiten und verändert dabei das Verhältnis, das wir kulturell
und gesellschaftlich zum Körper einrichten. Das ist Bestandteil des allgemeinen
Bewusstseins und Gegenstand weit verbreiteter Sorgen. Der menschliche Leib wird durch die Kenntnis des Genoms auf eine neuartige
Weise erfahrbar und auch manipulierbar. Die Macht, die damit entsteht, kann
zur Prognostik, Prävention und Therapie z.T. bisher unbehandelbarer Leiden
genutzt werden. Die Medizin wird durch den molekularen Aspekt revolutioniert.
Auch ein Bestandteil dieses allgemeinen Bewusstseins ist die Tatsache, dass
das HGP gleichzeitig Missbrauchspotentiale und neue moralische Dilemmas schafft.
Es sind nicht nur Hoffnungen, sondern auch Lasten mit der molekularen Medizin
verbunden. Kommt es sogar zu Situationen, wo unsere Verantwortung überlastet
wird? Reicht unsere Verantwortungskompetenz so weit wie unsere Manipulations-
und Kontrollmacht reicht? Nicht nur der offensichtliche Missbrauch und seine
Verhinderung, sondern auch der "normale" Gebrauch in der Medizin ist
mit beunruhigenden ethischen Fragen verbunden, denen sich unsere Gesellschaft
stellen muss. Das HGP hat spezifische Folgen in allen Sparten der Medizin und weit über die Medizin hinaus, die heute erst zu einem kleinen Teil absehbar sind. Eine unmittelbare forschungspolitische Folgerung ist meiner Ansicht nach, dass wir (die Gesellschaft) zum eigenen Vorteil Anstrengungen unternehmen sollten, um diese Folgen prospektiv zu untersuchen und zu diskutieren, bevor sie wegen blosser Macht der Fakten dann dereinst unlösbar gemacht worden sind. Das HGP verlangt eine begleitende Erforschung der ethischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Implikationen, sog. ELSI-Begleitforschung. In der Schweiz wurde sie bisher noch nicht systematisch etabliert, im Gegensatz zu anderen Ländern, wie Deutschland oder die USA. Ich möchte einen Gedanken zur Diskussion stellen, der mit den beiden Begriffen im Titel "Menschenbild" und "Ethik", und mit ihrem Zusammenhang unmittelbar zu tun hat. Ethik und Menschenbild sind nicht getrennte Bereiche: Denn wir verstehen ethische Probleme im Zusammenhang von und mit Hilfe von Vorstellungen unserer eigenen Identität, unseres Wesens, unseres Schicksals, unserer Ziele, unserer Hoffnungen. Diese sind vom HGP wesentlich betroffen. Ich sehe in der Genetik eine kollektive Unternehmung zur Neubeschreibung des Menschen und von Leben allgemein. Diese Vorstellungen unserer eigenen Identität, unseres Wesens, unseres Schicksals, unserer Ziele, unserer Hoffnungen werden durch die Vermutung einer inneren Determinierung durch Gene verändert. Erst recht durch die Wissbarkeit genetischer Information. Beziehungen werden neu konfiguriert: Nicht nur Beziehungen zu anderen Menschen, deren genetische Anlagen ich möglicherweise wissen kann. Indem ich selbst meine eigenen genetischen Eigenschaften erfahren kann (zumindest kleine Bruchstücke), wird unterhalb der spürbaren Oberfläche und sinnlichen Erfahrbarkeit des eigenen Leibes eine Ebene von Bestimmungsfaktoren vermutet, die uns verborgen sind, sich nur mittels technischer Massnahmen - den Gentests - erfahren lassen. Der Leib ist das Stück Natur, das wir selbst sind (Gernot Böhme). Insofern ist mit der Umstimmung des Leibverhältnisses immer auch eine Umstimmung des Naturverhältnisses verbunden. Identität ist aber etwas, was sich in solchen Beziehungen ergibt. Unsere Identität, also das, was wir von uns selbst glauben, wer wir sind, ist ein Ergebnis der Auslegung von Abgrenzungen, unter anderem gegenüber der Natur, die wir selbst nicht sind. Das "Menschenbild" oder unsere Identität als "Menschen" entsteht dabei aber kommunikativ, in Beziehungen zu anderen. Die Formung dieses Beziehungsbegriffes ist eine kollektive menschliche Aktivität, für deren Sorgfalt wir ethische Verantwortung tragen. Ein zentrales Element in diesem identitätsstiftenden Auslegungsverhältnis ist das folgende: Wir begegnen dem Unbekannten immer mit gewissen Vorverständnissen. Wir integrieren es in unser Weltverständnis. Für Unbekanntes müssen wir Interpretationsmuster finden. Gene, die DNA, sind zunächst Unbekanntes. Sie traten hinein in Diskurse, die sich bereits um das Wesen des Menschen auseinandersetzten. Die Figur war bereits entstanden, dass es ein inneres Wesen gebe, das die Dinge, auch die Menschen von innen heraus organisiere und sie zu dem mache, was sie sind. Was lag näher als zu vermuten, die DNA gehöre zu diesen inneren wesensstiftenden Faktoren? Was früher Seele hiess, wird heute oft mit DNA identifiziert. Anders könnte man gar nicht vermuten, dass ein Klon eine Vervielfachung derselben Persönlichkeit ist. Wir wissen aber, dass diese Vermutung falsch ist. Die DNA erfüllt diese essenzialistischen Erwartungen nicht. Für mich ein erstaunlicher Vorgang dieses Jahres ist die Offenlegung der
menschlichen Genomsequenz. 3 Milliarden Basenpaare bilden bloss gerade 30-40'000
Gene (gezählt nach Promotersequenzen). Weitestgehend unverstanden ist,
wie es möglich ist, dass sich ein so hochkomplexes und sensitives Entwicklungssystem
Mensch mit nur so wenigen molekularen Bestimmungsfaktoren überhaupt erfolgreich
differenzieren und entwickeln kann. Gleichzeitig sind die Zeitungen um diese
Zeit voll gewesen mit verständlichen Erklärungen und Kommentaren.
Das Unerklärliche können wir also doch irgendwie verstehen. Wir interpretieren
es und bauen es ein in unsere Welt- und Menschenbilder. Interpretation schleicht
sich sogar dort ein, wo auf das fehlende Verständnis hingewiesen wird.
Das Titelblatt zum Zeit dokument Nr. 1, 2001 "Das menschliche Genom"
enthält z.B. den folgenden Satz: Eine Konsequenz daraus ist: was genetische Information ist, was sie für Betroffene bedeutet, ist nicht klar verständlich, ohne die Kontexte der Interpretation mitzuberücksichtigen. In die Entscheidungen fliesst nicht pures Faktenmaterial über die DNA ein, sondern interpretierte Information. Genetische Informationen, die so entstehen und entscheidungsrelevant werden, verändern das Leben, schaffen für alltägliche Lebensentscheidungen neue Voraussetzungen. Entscheidungen, die vorher keine "genetischen" waren, werden jetzt zu "genetischen Entscheidungen". Zum Beispiel ein Kind zu bekommen, wird zu einer Entscheidung mit einer genetischen Komponente. Gute Beziehungen zu den Familienmitgliedern unterhalten, schliesst nun in der Wahrnehmung von Betroffenen unter Umständen ein, ihnen gewisse genetische Informationen weiterzusagen, die sie brauchen können. Das können aber bad news sein - Informationen über ihnen drohende Krankheiten. Thesen: Das genetische Programm als nach wie vor vorherrschendes Muster hat folgende
Implikationen: Der Körper wird wahrgenommen als heteronome Struktur, unter
der Kontrolle eines genetischen Programms. Unsere Daseinsweise ist ein Ausführen
von codiert mitgeführten Instruktionen und das Produziertsein durch die
Befolgung dieser Instruktionen. Ein kontextuelles, "systemisches" Genverständnis, das heute
angesichts der molekularbiologischen Faktenlage eigentlich näher liegen
würde, hätte andere Implikationen. Der Körper ist eine aktiv
selbstorganisierende Struktur, die der DNA in jedem einzelnen Entwicklungsschritt
die Informationqualität selektiv verleiht. Dasein ist dann ein Sich-selbst-finden
in Beziehungen zur Umwelt und ein gegenwärtiger Gestaltungsprozess, dessen
Regelmässigkeit genauso aktuell hervorgebracht ist, wie die Abweichungen
von der Regel.
|
||||||||||||||||||||||||
|
|

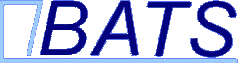


 Produkten.
Produkten.