|
Sie sind hier: Biosicherheit > Technikfolgen > Forum 1997 > TA-Österreich
Technikfolgen-Abschätzung in Österreich, Brücke zwischen
Technik und Administration
Gunther TICHY. Wien
Das Institut für Technikfolgen-Abschätzung ist an der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften verankert; seine Gründung geht letztlich
auf das Jahr 1985 zurück, als auf Wunsch des Wissenschaftsministers
eine diesbezügliche Arbeitsgruppe am Institut für Sozioökonomische
Entwicklungsforschung eingerichtet wurde. Aus ihr ging im Rahmen einer
wechselvollen Geschichte und nach Evaluierung das heutige Institut für
Technikfolgen-Abschätzung (ITA) hervor. Es ist streng interdisziplinär
ausgerichtet; seine Mitarbeiter vertreten die Disziplinen Volkswirtschaftslehre,
Betriebswirtschaftslehre, Soziologie, Politikwissenschaften, Psychologie,
Kommunikationswissenschaften, Rechtswissenschaften, Molekularbiologie,
Physik, Nachrichtentechnik sowie Elektrotechnik. Sie verstehen sich
jedoch als TA-Experten und ziehen für spezifische Fachfragen vielfach
Fachexperten von aussen heran. Die Finanzierung des Institutes erfolgt zu
einem Viertel aus Mitteln der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, zu einem viertel aus einem eigenen Budgetansatz
Technikfolgen-Abschätzung des Wissenschaftsministeriums sowie zur
Hälfte aus Drittmitteln; als Drittmittel in diesem Zusammenhang sind
sowohl Mittel wissenschaftlicher Fonds, Gelder der EU, wie auch
Auftragsgelder zu verstehen.
Das Parlament ist in Österreich an Technikfolgen-Abschätzung wenig
interessiert; es ist generell eher schwach und politisch nicht führend tätig;
im grossen und ganzen diskutiert es und bestätigt - eventuell modifiziert -
Absprachen der Sozialpartner oder Regierungsanträge. Demgemäss
spielt sich Technikfolgen-Abschätzung in Österreich zumeist im Vorfeld
der Gesetzwerdung und bei der Reparatur von Fehlentscheidungen ab:
Die Ministereien, die die Gesetzesentwürfe vorbereiten, haben vielfach
Interesse an TA, und zwar i.d.R. an partieller TA, und sie sind auch wichtige
Auftraggeber des Instituts für Technikfolgen-Abschätzung; zu erwähnen
ist primär das Wissenschaftsministerium, das auch wichtige
Technologiekompetenzen hat, das (ehemalige) Verkehrsministerium und
das Umweltministerium. Problematisch an der Zusammenarbeit des
Instituts für Technikfolgen-Abschätzung mit der Administration ist primär
der Zeitdruck; gute Lösungen sind nur möglich, wenn das Institut selbst
bereits Vorleistungen erbracht hat, d.h. Themen im Vorlauf bearbeitet,
bevor sie noch politisch relevant werden, um dann rasch entsprechende
Expertisen liefern zu können.
Im Bereich der projektbezogenen Arbeit beschränkt sich das ITA auf
partielle TA und konzentriert sich dabei jeweils auf die Teilaspekte, die
gesamtwirtschaftlich und gesellschaftlich auf absehbare Zeit am
Relevantesten erscheinen. Wegen seiner geringen Grösse von knapp einem
Dutzend Mitarbeitern ist jedoch eine darüber hinausgehende Konzentration
der Arbeit erforderlich, und zwar auf vier bzw. fünf Themenfelder und zwei
Querschnittsmaterialien . Die vier traditionellen Themenfelder sind
Telekommunikation, Umwelt - und zwar im besonderen clean technologies
und Diffusion -, Biotechnologie und Medizintechnik, wozu in letzter Zeit als
fünftes Gebiet, halb unfreiwillig, Technologiepolitik gekommen ist. Innerhalb
dieser vier bzw. Für Themenfelder konzentriert sich die Arbeit des Instituts
auf die beiden Querschnittsmaterien Regulierung einerseits und
Schnittstellenprobleme von Technik und Organisation andererseits. Die
folgende Übersicht gibt einen groben Eindruck der Arbeit des ITA auf den
einzelnen Themenfeldern und Querschnittsmaterien; natürlich entbehrt
die Einordnung nicht einer gewissen Willkürlichkeit - Pfeile sollen daher die
Arbeiten angeben, die in besonderem Masse mehrerer Themenfelder
betreffen. Exemplarisch sollen im Referat die drei fettgedruckten Studien
besprochen werden, an denen sich unsere Arbeitsweise und unsere
Intentionen gut zeigen lassen.
|
Regulierung |
Schnittstellenprobleme Technik/Organisation |
| Telekommunikation |
Umwelteffekte der Telekommunikation
TA der Breitbandkommunikation
Telekommunikationsinfrastruktur in der CSR
Universaldienst
Interconnection
Konsumentenschutz: Der Verbraucher im Netz |
Lokale innerbetriebliche Kommunikationsnetze
Interakt. Komm.dienst f.d.europ.Parlament
Inform
Telearbeit im ländlichen Raum (ANAGO)
Telearbeit in Nachbarschaftsbüros (OFFNET)
Arbeitsplatzeffekte der Telekommunikation |
| Medizintechnik |
Folgen der Einführung einer Patientenkarte |
↑ Das digitale Krankenhaus (SMZO) ↑
Soziale Folgen der Technisierung der Medizin
Aufrecherhaltung der Selbständigkeit im Alter
Integration älterer Menschen durch Technologie
← MTA: Gerätebeschaffung |
| Biotechnologie |
Risikobeurteilung der ökologischen Effekte von
Nutzpflanzen nach dem Konzept der Vertrautheit
Freisetzungspraxis GVO in Europa
Sozialverträglichkeitbestimmung v.gentechn.
Produkten |
Auswirkungen von Genanalysen
Perzeption der Biotechnologie in
d.österr.ÖffentlichkeitUmwelt-Verträglichkeits-Prüfung
|
| Umwelt |
Technikbewertung von Aerogelen
Infosystem zur vergleichenden Bewertung von
Cleaner technologies (BAT) →
Umwelt-Verträglichkeits-Prüfung → |
Operationsalisierung des Konzepts cleaner
production |
Technologie-
Politik |
|
Folgenanalyse der Fusionsforschung in Österreich
Technologie-Delphi |
|

Suchen Sie bei antikoerper-online.de.
Passende Antikörper aus über  Produkten.
|
|

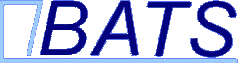


 Produkten.
Produkten.