|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Gesamte Dokumentation:
5. Sicherheitsanalyse für offene AnwendungenDie Sicherheitsanalyse hat zum Ziel, möglichst alle Ziel- und Nebeneffekte nach ihren Auswirkungen zu untersuchen und zu bewerten. Sie wird daher in den folgenden 4 Schritten vollzogen: 1. SicherheitsaspekteDie genaue Analyse von Sicherheitsaspekten spielt bei der TA eine sehr grosse Rolle. Ziel- und Nebeneffekte müssen so weit wie möglich bekannt sein. Bei transgenen Pflanzen müssen insbesondere Lebensmittelsicherheit (Toxizität und Allergizität) sowie Umweltsicherheit in Betracht gezogen werden. 2. LebensmittelsicherheitZiel der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion ist es, gesunde Nahrungsmittel in hochwertiger Qualität und ausreichender Menge herzustellen. Gemäss dieser Zielsetzung stellen sich für die Pflanzenzüchtung immer wieder neue Herausforderungen. So hat beispielsweise die Züchtung ertragssicherer Sorten mit Resistenzen gegenüber Krankheiten und Schädlingen sehr an Bedeutung gewonnen. Die Qualität eines Nahrungsmittels wird von vielfältigen Einflussgrössen bestimmt. Quantitative und qualitative Schwankungen in der Zusammensetzung der Inhaltsstoffe beispielsweise können als Ergebnis folgender Einflussgrössen gesehen werden:
Die erwähnten Einflussfaktoren sind dafür verantwortlich, dass die Zusammensetzung eines Lebensmittels keine Konstante ist. Vielmehr bewegen sich die Qualität und der damit zusammenhängende Gehalt an Inhaltsstoffen beträchtlich. Ein sehr illustratives Beispiel dazu ist die Wetterabhängigkeit des Zuckergehaltes und des Auftretens anderer Geschmackstoffe in der Traube. Von ähnlichen, umweltbedingten Schwankungen in der Qualität und in der Zusammensetzung ist bei andern Lebensmittel auszugehen. Es gestaltet sich relativ schwierig, Grenzen für zulässige Konzentrationsbereiche für Inhaltsstoffe von Lebensmitteln festzulegen. Auszuschliessen sind gesundheitsschädliche Konzentrationen von toxischen Inhaltsstoffen. Dabei ist festzuhalten, dass nicht eine absolute Abwesenheit von toxischen Substanzen sicherzustellen ist. Vielmehr kann der Gehalt beispielsweise durch Lager- oder Zubereitungsvorschriften auf einen tolerierbaren Wert gesenkt werden. Die Sicherheit der Lebensmittel basiert denn auch auf dem Konzept, dass von einem Lebensmittel, das unter den vorgesehenen Bedingungen konsumiert wird, mit hoher Gewissheit keine Gefahr ausgehen soll. Historisch wurden Lebensmittel auf Grund der Erfahrung als sicher betrachtet, auch wenn sie natürliche toxische Substanzen in nicht schädlichen Mengen enthielten. Mögliche nachteilige Auswirkungen der erwähnten Einflussfaktoren auf pflanzliche Lebensmitteln sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Zugleich sind Massnahmen zur Gewährleistung der Unbedenklichkeit aufgeführt. Mit dem Einsatz gentechnologischer Methoden in der Pflanzenzüchtung hat sich das Interesse der Öffentlichkeit an der Sicherheit von Lebensmitteln verstärkt. Gentechnisch veränderte Lebensmiteln stossen auf grosse Skepsis und ihre Unbedenklichkeit wird in Frage gestellt, obwohl deren Sicherheit im Laufe von behördlichen Bewilligungsverfahren eingehend untersucht wird. Obschon die Gentechnologie den Rahmen der Möglichkeiten, Pflanzen zu verändern erweitert hat, kann nicht notwendigerweise abgeleitet werden, dass transgene Lebensmittel weniger sicher sind, als solche, die mit Hilfe traditioneller Techniken gezüchtet wurden. Vielmehr trägt die Molekularbiologie zu einer gezielteren Analyse von Lebensmittel bei und erweitert das Wissen über kritische Vorgänge in Organismen. Die Bereitstellung sicherer Lebensmittel wird dadurch wesentlich unterstützt.
Grundsätzlich werden die negativen Auswirkungen von Lebensmitteln in zwei Kategorien unterteilt, in toxische und nicht-toxische Lebensmittelreaktionen (Abb. 1). Die nicht-toxischen negativen Auswirkungen werden weiter in Lebensmittelallergien und Lebensmittelintoleranzen gegliedert. Toxische Lebensmittelauswirkungen betreffen alle exponierten Menschen und beruhen auf Inhaltsstoffen oder Verunreinigungen aus dem Produktions- oder Verabeitungsverfahren. Nicht-toxische Lebensmittelreaktionen sind nur für Personen von Bedeutung die eine entsprechende Anfälligkeit besitzen. Allergie bezeichnet die immunologisch-begründete Reaktion von Lebensmitteln, während sich Intoleranz auf nicht-immunologische Reaktionen bezieht (z.B. Lactoseintoleranz). Im Folgenden sollen die Vorgehen zur Gewährleistung der Sicherheit von transgenen Lebensmitteln bezüglich toxikologischer und allergenen Substanzen näher erläutert werden. 2.1 Toxikologische UnbedenklichkeitFür Lebensmittel oder Lebensmittelkomponenten aus gentechnisch veränderten Organismen wird die Sicherheit mit Hilfe der substantiellen Äquivalenz bestimmt. Die gentechnisch veränderten Lebensmittel werden dabei mit bestehenden analogen Lebensmitteln verglichen. In den meisten Fällen dienen bekannte Kulturpflanzen als Empfängerorganismen für die gentechnische Veränderung. Das Konzept der substantiellen Äquivalenz verwendet demnach bekannte Lebensmittel als Vergleichsbasis. Bezeichnend ist wiederum, dass keine absolute Äusserung über die Sicherheit getätigt wird, sondern eine vergleichende Aussage: das gentechnisch veränderte Lebensmittel ist ebenso sicher wie das unveränderte Ausgangsprodukt. Die Zusammensetzung von Lebensmitteln ist meist gut dokumentiert, vor allem über mögliche toxische Inhaltsstoffe, kritische Nährstoffe (z.B. Vitamine) oder andere relevante Eigenschaften sind Daten verfügbar. Deshalb können die entsprechenden Konzentrationen von gentechnisch veränderten Produkten mit diesen verglichen werden. Für den Nachweis der substantiellen Äquivalenz werden eine Anzahl besonderer Aspekte verwendet, wie:
Jede klassisch oder gentechnisch erzeugte Neuzüchtung birgt potentiell das Risiko unerwünschter biochemischer Veränderungen. Die genomische Variation hat zur Folge, dass Funktionsabläufe verändert werden, die sich phänotypisch in veränderten Merkmalsausprägungen äussern. Ob die Anwendung gentechnischer Methoden zu einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit solcher Effekte führt, wurde eingehend diskutiert. Zuchtziele der Pflanzenzüchtung stellen sehr komplexe Merkmalskombinationen dar. Es gilt Ertrag, Qualität und Resistenzen in einem Genotyp zu vereinen. Der physiologische und genetische Hintergrund ist zudem nur in Ansätzen bekannt. Im Falle der klassischen Kombinationszüchtung werden komplette Genome verschiedener Ausgangslinien neu kombiniert, in der Hoffnung unter den Kreuzungsprodukten die gewünschte Merkmalskombination selektieren zu können. Im Falle des Gentransfers bei Anwendung gentechnologischer Methoden werden nur die gewünschten Zielgene übertragen bzw. nur bekannte Genprodukte exprimiert. Nur bei dieser Methode ist deshalb eine toxikologische Überprüfung konkret möglich, da diese bekannt sind. Bei transgenen pflanzlichen Lebensmitteln sind die neu eingeführten Proteine im Rahmen von Bewilligungsverfahren auf ihre Toxizität zu überprüfen. Toxikologische Untersuchungen sind vor allem dann angebracht, wenn die neuen Proteine bisher nicht in der Nahrungsmittelkette vorkamen oder pflanzliche Inhaltsstoffe wesentlich in ihrem Gehalt verändert wurden. Zur Überprüfung des toxischen Potentials transgener Genprodukte, verantwortlich beispielweise für Insektenresistenzen, Herbizidtoleranzen und Antibiotika-Resistenzen stehen Standardmethoden zur Verfügung. So werden beispielsweise Verdauungstudien und Fütterungsversuche sowohl mit den isolierten Genprodukten, als auch mit dem gentechnisch veränderten Pflanzenmaterial durchgeführt. Auf dieser Basis sind konkrete Aussagen über die Unbedenklichkeit im Rahmen der üblichen Verzehrsgewohnheiten möglich. Schwierigkeiten ergeben sich erst in der Beurteilung möglicher Langzeitwirkungen einer Aufnahme subtoxischer Mengen des Genproduktes. Die Wirkungen geringer Stoffmengen sind generell schwer zu erfassen, dies gilt auch für die der nicht-transgenen Lebensmittel. Neben den Gentechnik bezogenen Bedenken dürfen die möglichen negativen Auswirkungen anderer Einflussfaktoren nicht vernachlässigt werden. Sie können ebenfalls Ursache von Gefahrenquellen sein. Die verschiedenen Pflanzenspecies weisen neben den primären Inhaltsstoffen eine bisher noch nicht erfasste Vielfalt an Sekundärstoffen auf. Der evolutionäre Vorteil dieser Inhaltsstoffe muss in der Bildung chemischer Abwehrmechanismen gegenüber fressenden Tieren gesehen werden. So sind eine Reihe von Bitterstoffen bekannt, die toxische oder abwehrende Wirkung gegenüber Bakterien, Pilzen oder Insekten aufweisen. Andere pflanzlichen Verbindungen wirken bei Genuss in geringen Mengen anregend oder sogar gesundheitsfördernd, in höheren Mengen jedoch können nachteilige gesundheitliche oder sogar tödliche Folgen auftreten. Die Unterscheidung in Gift-, Gewürz- und Bitterstoffe gibt diesen Zusammenhang andeutungsweise wieder. Unerwünschte Bitterstoffe und toxikologisch bedenkliche Inhaltstoffe wurden im Verlauf der Züchtung herausgezüchtet oder durch eine Anpassung der Aufbereitung und der Verzehrsgewohnheiten unschädlich gemacht. Toxikologische Gefährdungen aufgrund der genomischen Variation werden bei den klassischen Züchtungsmethoden aufgrund der langjährigen Erfahrungen mit dem Zuchtmaterial als sehr gering erachtet. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Genprodukte im Einzelnen nicht bekannt sind und Selektionen hauptsächlich über das äussere Erscheinungsbild oder Geschmackstests erfolgen. Weitere wichtige Gefahrenquellen bezüglich der Unbedenkichkeit von Lebensmitteln ergeben sich aus den Anbautechniken und den Verarbeitungsverfahren. Acker-, Obst und Gemüsepflanzen werden während ihres Wachstums und der späteren Lagerung von zahlreichen pilzlichen oder bakteriellen Krankheiten und Schädlingen befallen. Zusätzlich konkurrieren sie mit Unkräutern um den Standort. Neben Ertragsausfällen treten auch Belastungen mit toxischen Stoffwechselprodukten von pilzlichen Krankheiten (Mykotoxinen) auf. Der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmitteln zur Kontrolle von Unkräutern und Schaderregern stellt in der konventionellen Landwirtschaft eine wichtige Massnahme zur Ertragssicherung dar. Wird auf den Einsatz von Herbiziden, Fungiziden oder Insektiziden wie im Falle des biologischen Landbaus verzichtet, muss mit Ertragsverlusten bis zu Totalausfällen gerechnet werden. Mit der Züchtung krankheits- und schädlingsresistenter, wie herbizidtoleranter Sorten ergeben sich neue Optionen im Pflanzenschutz. Die Einsparung und die Substitution von chemischem Pflanzenschutzmittel ist eine wichtige Zielsetzung. 2.2 AllergeneDer menschliche Körper kann auf bestimmte Proteine mit einer Unverträglichkeitsreaktion reagieren, bei der das Immunsystem beteiligt ist. Es ist bekannt, dass potentiell fast alle Proteine (Immunoglobin E-vermittelte) Allergien auslösen können. Rund 90 Prozent aller Lebensmittelallergien werden von wenigen Lebensmitteln verursacht (darunter Kuhmilch, Hühnerei, Fisch, Nüsse, Sojabohne, Weizen, Krustaceen). Alle bisher isolierten Allergene sind Proteine, die charakteristische Eigenschaften aufweisen. Allergiker meiden aus Erfahrung diejenigen Nahrungsmittel, die für sie die allergieauslösenden Proteine beinhalten. Mittels der Gentechnik kann die Pflanzenzüchtung nun theoretisch das Erbmaterial der Gesamtheit aller Organismen als Genquelle nutzen. Das Transgen bildet dann im Empfängerorganismus ein Fremdprotein. Auch das Expressionsmuster arteigener Genprodukte kann mittels Gentechnik stark variiert werden. Hier stellt sich die Frage, ob durch die gentechnische Veränderung Allergien zunehmen werden. Für die Beurteilung des Allergie-Risikos gentechnisch veränderter pflanzlicher Lebensmittel ist die Frage nach der Herkunft des Genproduktes entscheidend (Abb. 2). Hier lassen sich prinzipiell folgende Schlussfolgerungen ziehen:
Für die bisher zugelassenen transgenen Nutzpflanzen wird nach gegenwärtigem Stand der Kenntnisse kein erhöhtes Risiko für allergische Reaktionen angenommen. Die verwendeten Gene bzw. Genprodukte (Herbizid- und Antibiotikaresistenzen, insektentoxische Proteine aus Bacillus thuringiensis oder virale Hüllproteine) stammen weder aus Quellen mit allergenem Potential, noch hat der Vergleich mit bekannten Allergenen Ähnlichkeiten ergeben. Virale Hüllproteine wurden bereits früher über die Nahrung aufgenommen. Einige pflanzliche Proteine, die für neue Resistenzen interessant wären (u.a. a -Amylase-Inhibitoren, Trypsin-Inhibitoren oder Lektine), weisen Ähnlichkeiten mit bekannten Allergenen auf. Vor der Markteinführung müssen derartig genetisch veränderte Pflanzen auf ihr allergenes Potential untersucht werden. Die Wahrscheinlichkeit unerwarteter Allergien kann bei gentechnisch veränderten Lebensmitteln dann grösser sein, wenn Genprodukte, die vorher nie Bestandteil der Nahrung waren und deren allergenes Potential nicht dokumentiert ist, übertragen werden. Die gleiche Unsicherheit besteht aber auch bei neu eingeführten nicht-transgenen Nahrungsmitteln. Bei der Zulassung von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln muss das allergene Potential der übertragenen Proteine grundsätzlich untersucht werden. Stellt das Genprodukt des übertragenen Transgens ein Allergen dar oder zeigt es Ähnlichkeiten mit einem solchen, so sollte auf eine Verwendung verzichtetoder eine sorgfältige und durchgängige Deklaration zur Pflicht gemacht werden.
|
||||||||||||||||||||||||
|
|

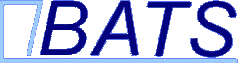

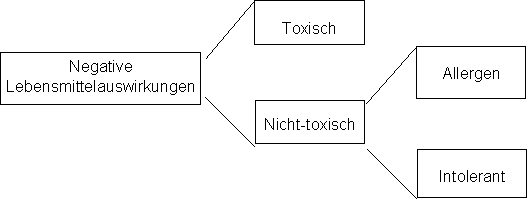
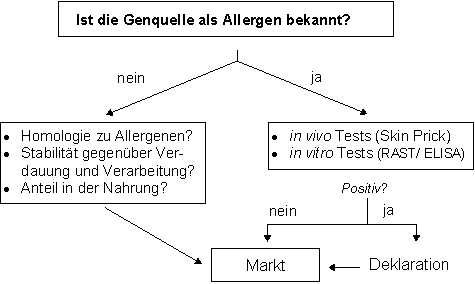

 Produkten.
Produkten.